
Albert Schweitzer, Annäherungen an ein Phänomen
Philosoph, Theologe, Mediziner, Organist, Weltgewissen, „Urwalddoktor“ und streitbarer Pazifist – wer sich Albert Schweitzers Leben und Wirken zu seinem 150. Geburtstag nähern will, kann dies auf vielen Pfaden tun.
Annäherungen an ein Phänomen

8-Promille-Gelder: Wer zahlt den Preis für Fehler, wenn der Staat keine Klarstellung vornimmt?
Ungeklärte Fehler und vertauschte Verantwortlichkeiten: der Fall ELKI und das Steuerparadoxon, das das Vertrauen in die Demokratie untergräbt.
Acht Promille: Ein obskurer Fehler und der Preis der Intransparenz
2019 wurde die Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien (ELKI) vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen über einen angeblichen Fehler bei der Übermittlung der Daten zu den 8 Promille 2014 informiert.
Nach Angaben des Ministeriums wurden ihr fälschlicherweise von einem nationalen Steuerberatungszentrum (CAF) Tausende von Unterschriften zugeteilt.
Dies ist die einzig sichere Tatsache heute. Der Fehler kann also nicht der ELKI zugeschrieben werden. Wie auch?
Dennoch verlangt der Staat von der Kirche die Rückgabe von mehr als 2,3 Millionen Euro, die bereits erhalten, verwendet und abgerechnet wurden, ohne klare Unterlagen vorzulegen oder anzugeben, wer tatsächlich geschädigt wurde.
In der Tat sind die bereitgestellten Dokumente unkenntlich gemacht, die Informationen unvollständig und eine Überprüfung ist nicht möglich.
Steuerliche Transparenz und Demokratie: Ein zerrissenes Band
Das Steuersystem ist nicht nur ein technischer Apparat. Es ist eine Grundstruktur der Demokratie. Steuern zu zahlen ist eine bürgerliche und kollektive Handlung, die die Gesellschaft stärkt, aber nur, wenn die öffentliche Verwaltung transparent, verständlich und zugänglich ist.
Wenn stattdessen die Bürokratie undurchsichtig wird und die Verantwortung auf diejenigen abgewälzt wird, die korrekt handeln, dann ist das Vertrauen in die Demokratie zerstört.
Die ELKI hat sich an das Gesetz gehalten, die Mittel pünktlich für Gemeinschaftsprojekte ausgegeben und alles in der offiziellen Buchhaltung dokumentiert. Und doch wird sie heute von einem öffentlichen System, das keine Erklärungen liefert, beschuldigt und schwer geschädigt.
Das Paradoxon: Wer Fehler macht, zahlt nicht, wer sich korrekt verhält, leidet
Was die ELKI riskiert, ist nicht nur die Einstellung sozialer, kultureller und karitativer Aktivitäten im ganzen Land. Ihr droht zudem ein irreparabler Imageschaden. Sie wird zu Unrecht in das weit verbreitete Vorurteil gegenüber jenen Institutionen hineingezogen, die „ohne Kontrolle Geld vom Staat annehmen“.
Gerade, wo sie zu den wenigen gehört, die Transparenz fordern und mit jedem erhaltenen Euro einen Mehrwert für die Gemeinschaft schaffen. Zumal das Ministerium, sollte der Fehler jemals nachgewiesen werden und somit in keiner Weise der ELKI zuzuschreiben sein, auch die bis heute im Überprüfungszeitraum aufgelaufenen Zinsen einfordern würde.
Echte Gerechtigkeit ist gefragt: Wer die Systeme garantiert, muss auch die Kosten tragen
Wenn der Fehler von einem nationalen CAF verursacht wurde, wie das Ministerium behauptet, dann ist es nur fair, dass die Kosten von denen getragen werden, die den Fehler verursacht haben: das heißt von denen, die die verwendeten IT-Systeme bereitstellen und im Austausch für die erbrachten Dienste garantieren, sowie von den Versicherungsunternehmen, die die Datenübertragungsprozesse schützen.
Es ist nicht hinnehmbar, dass in einem Rechtsstaat die finanzielle Belastung für die Fehler anderer auf diejenigen abgewälzt wird, die richtig gehandelt haben.
Der Grundsatz der Rechenschaftspflicht muss auch für öffentlich Einrichtungen und die sie unterstützenden autorisierten Stellen gelten.
Der demokratische Pakt steht auf dem Spiel
Diese Angelegenheit betrifft jeden von uns. Hier geht es um das Verhältnis zwischen Staat und Bürger, zwischen Institutionen und Gemeinschaft. Es geht um den demokratischen Pakt, der auf Vertrauen, Rechtmäßigkeit und Transparenz beruht.
Wenn diese Grundsätze ins Wanken geraten, ist es nicht nur die ELKI, die verliert, sondern die Gesellschaft als Ganzes.

LWB ruft zum Ende des Iran-Israel-Konflikts auf
Erklärung fordert Deeskalation eines Konflikts, der „eine bereits fragile Region und den globalen Frieden bedroht“.
Kirchen und Religionsführer sollen Stimme für Gerechtigkeit und Frieden erheben
(LWI) – Der Lutherische Weltbund (LWB) hat die Regierungen des Iran und Israels eindringlich dazu aufgerufen, alle eskalierenden Handlungen im jüngsten Konflikt zwischen den beiden Ländern unverzüglich zu beenden. Der aktuelle Konflikt war am13. Juni ausgebrochen. Der LWB bezeichnete diesen als „eine unmittelbare und gefährliche Bedrohung für eine bereits fragile Region und für den globalen Frieden.“
Die Erklärung, die im Namen der weltweiten Kirchengemeinschaft von 154 lutherischen Mitgliedskirchen veröffentlicht wurde, fordert zudem die Vereinten Nationen auf, ihre diplomatischen Bemühungen zu verstärken: „zur Vermittlung, Überwachung und Deeskalation der Krise sowie zur Rechenschaft aller Parteien im Hinblick auf das Völkerrecht und den Schutz der Zivilbevölkerung.“
Die Erklärung lädt Kirchen und Religionsführer weltweit dazu ein, ihre Stimme für Gerechtigkeit und Frieden zu erheben: „Gleichgültigkeit ist keine Option.“ Sie bekräftigt die langjährige Überzeugung des LWB, dass „dauerhafter Frieden nur durch Dialog, die Achtung des Völkerrechts und den Schutz der Menschenwürde aller Menschen erreicht werden kann.“

Gaza: Wann soll eine Kirche ihre Stimme erheben?
Die vorherige Version dieses Artikels hat eine lebhafte Debatte ausgelöst, über die wir uns freuen. Aus Respekt gegenüber den Teilnehmern möchten wir einige unklare Passagen präzisieren, damit die Diskussion fortgesetzt und vertieft werden kann. Es muss hinzugefügt werden, dass der Dialog wichtig ist und nicht abgebrochen werden darf.
Wann und für wen?
Angesichts der Krise im Gazastreifen muss die Kirche den Sinn ihres Zeugnisgebens hinterfragen.
Wann und für wen erheben wir die Stimme und brechen das „diplomatische Schweigen“?
Schon immer ist die Kirche aufgerufen, für die Letzten, die Geschundenen und Gefolterten einzustehen. Sie ist Stimme derer, die gerade keine Stimme haben – und das kann sich im Laufe der Geschichte durchaus immer mal wieder ändern. Aus der tragischen Geschichte Deutschlands während des Naziregimes haben wir gelernt, dass es falsch ist, in Schweigen zu verharren und geschehendem Unrecht nicht Widerstand zu leisten, wenn Kirche sich mit dem Unrecht, dem herrschenden Regime verbündet. Statt einzustehen für die, denen Unrecht angetan wird. Auch damals gab es einzelne mutige Stimmen, die im Namen des Evangeliums ihre Stimme erhoben, die dem Wort Gottes Folge leisteten, von den Propheten bis zu Jesus Christus, für die einzustehen, die sich nicht wehren können. Dies ist keine politische Stellungnahme, sondern die Notwendigkeit der Verkündigung vom Wort Gottes, welches zu Gerechtigkeit und Frieden aufruft. Immer und überall.

Ein Drama, das uns angeht
Inmitten der humanitären Katastrophe im Gazastreifen klingen viele Worte heute eher wie vorsichtige diplomatische Appelle denn wie ein Echo evangelischer Radikalität.
Verurteilungen ja, aber mit vielen Ausnahmen. Obwohl es doch für alle sichtbar ist: Die Tragödie hat die Ausmaße eines Völkermords angenommen. Diesen Begriff nicht zu verwenden, schützt uns nicht, sondern stellt uns bloß.
Gerade hat die israelische Regierung die Errichtung von 22 neuen Siedlungen im Westjordanland genehmigt, die größte Ausweitung seit Jahrzehnten. Einige sind Wiederansiedlungen in einem Gebiet, das 2005 im Rahmen eines Rückzugplans von Israel geräumt worden war. Die erklärte Strategie? Die Palästinenser aus dem Gazastreifen vertreiben und die Kontrolle darüber übernehmen. Worte und Taten, die wir nicht stillschweigend hinnehmen können. Weitere Angriffe auf Nachbarstaaten, in „vorauseilender Verteidigung“, machen alle Friedensverhandlungen, die auf Dialog und Überwindung der Feindseligkeiten gründen, zunichte.
Das „erschütternde“ Wort Gottes in die Tat umsetzen
Und hier kommt der Glaube ins Spiel. Die Kirchen können sich nicht darauf beschränken, innerhalb der bestehenden geopolitischen Debatte nach Spielräumen zu suchen.
Das Wort der Kirchen muss manchmal auch erschüttern, Gewissheiten nehmen, unbequeme Fragen stellen. Das haben die Propheten schon immer getan, und Jesus von Nazareth steht in dieser Tradition – er hat Unrecht beim Namen genannt, Schuld aufgedeckt – und so den Weg geebnet für das befreiende Wort Gottes, der zu Umkehr befähigt und Gerechtigkeit und Frieden will und schafft. Wenn wir auf das Wort Gottes hören, so unbequem, und nicht Geld einbringend, es dann auch sein kann.
Jede Christin und jeder Christ sollte sich fragen: Was kann ich tun?

Die Politik der israelischen Regierung zu verurteilen, ist kein Antisemitismus. Wer hingegen schweigt, läuft Gefahr, sich schuldig zu machen. Wir sehen uns in Solidarität mit vielen Israeliten, in Israel, Palästina und auf der ganzen Welt, die gegen das Regime von Netanjahu protestieren und sich davon abgrenzen. Ein politisches Regime für seine Missachtung der Menschenrechte anzuklagen hat überhaupt nichts mit dem Volk Israel zu tun.
Deutschland und Italien, ganz Europa rüstet auf, Israel radikalisiert sich, Palästina stirbt. Keiner dieser Fakten ist neutral. Weder untereinander, noch für uns.
Bewusstes Zeugnis
Wir sind eine kleine Kirche. Dessen sind wir uns bewusst. Aber wir sind auch eine Kirche, die an die Macht des Wortes glaubt, nicht an die eigene; an die Macht des Glaubens und der Gnade; an den Wert der Geste.
Wir wollen uns nicht auf ein Symbol, eine Flagge oder eine Spendenaktion beschränken. Wir wollen Verantwortung übernehmen und Zeugnis ablegen.
Das Wort Gottes ist nicht neutral. Es ist kein altmodischer Trost. Es ist ein Wort, das jede und jeden erschüttert, das uns unserer Gewissheiten beraubt und uns zwingt, in uns selbst und um uns herum zu blicken.
Wenn die Politik heute stottert, müssen die Kirchen den Mut haben zu sagen, „Es reicht!“

Dem Hass trotzen
Aus Bonhoeffers Rede auf der ökumenischen Fanö-Konferenz, gehalten am 28.8.1934
„Ach daß ich hören sollte, was der Herr redet, daß er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen“ (Ps. 85,9) … Unsere theologische Aufgabe besteht darum hier allein darin, dieses Gebot als bindendes Gebot zu vernehmen und nicht als offene Frage zu diskutieren. „Friede auf Erden“, das ist kein Problem, sondern ein mit der Erscheinung Christi selbst gegebenes Gebot. Zum Gebot gibt es ein doppeltes Verhalten: den unbedingten, blinden Gehorsam der Tat oder die scheinheilige Frage der Schlange: sollte Gott gesagt haben? Diese Frage ist der Todfeind des Gehorsams, ist darum der Todfeind jeden echten Friedens.(…)
Wer Gottes Gebot in Frage zieht, bevor er gehorcht, der hat ihn schon verleugnet.
Friede soll sein, weil Christus in der Welt ist, d. h. Friede soll sein, weil es eine Kirche Christi gibt, um deretwillen allein die ganze Welt noch lebt. Und diese Kirche Christi lebt zugleich in allen Völkern und doch jenseits aller Grenzen völkischer, politischer, sozialer, rassischer Art, und die Brüder dieser Kirche sind durch das Gebot des einen Herrn Christus, auf das sie hören, unzertrennlicher verbunden als alle Bande der Geschichte, des Blutes, der Klassen und der Sprachen Menschen binden können. (…)
Wie wird Friede? Durch ein System von politischen Verträgen? Durch Investierung internationalen Kapitals in den verschiedenen Ländern? d. h. durch die Großbanken, durch das Geld? Oder gar durch eine allseitige friedliche Aufrüstung zum Zweck der Sicherstellung des Friedens? Nein, durch dieses alles aus dem einen Grunde nicht, weil hier Friede und Sicherheit verwechselt wird. Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit. Denn Friede muß gewagt werden, ist das eine große Wagnis, und läßt sich nie und nimmer sichern. Friede ist das Gegenteil von Sicherung.
Wer ruft zum Frieden, daß die Welt es hört, zu hören gezwungen ist?
Die einzelne Kirche kann auch wohl zeugen und leiden – ach, wenn sie es nur täte – aber auch sie wird erdrückt von der Gewalt des Hasses. Nur das Eine große ökumenische Konzil der Heiligen Kirche Christi aus aller Welt kann es so sagen, daß die Welt zähneknirschend das Wort vom Frieden vernehmen muß und daß die Völker froh werden, weil diese Kirche Christi ihren Söhnen im Namen Christi die Waffen aus der Hand nimmt und ihnen den Krieg verbietet und den Frieden Christi ausruft über die rasende Welt. Warum fürchten wir das Wutgeheul der Weltmächte? Warum rauben wir ihnen nicht die Macht und geben sie Christus zurück? Wir können es heute noch tun.“


Papstwahl, evangelisch-lutherische Kirche: Respekt und ökumenische Hoffnung
Die ELKI begrüßt Papst Leo XIV. mit Respekt und hofft auf die Fortsetzung des ökumenischen Dialogs für einen gemeinsamen und gelebten Frieden und Gerechtigkeit in der Welt.
Eine Chance zum Dialog
Mit der Wahl von Papst Leo XIV., geboren als Robert Francis Prevost, tritt die römisch-katholische Kirche in eine neue Phase ihrer spirituellen und institutionellen Entwicklung ein.
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien (ELKI) wünscht dem neuen Pontifex Gottes Segen für seine Aufgabe.
Und erkennt in der ersten Ansprache den nachdrücklichen Aufruf zu Frieden, Gerechtigkeit und Verantwortung gegenüber der Schöpfung – historisch relevante Themen im Denken und Engagement der lutherischen Gemeinden in Italien und in der Welt.
Das Papsttum: theologische Distanz
Die ELKI betont zwar, dass das Papsttum weiterhin ein distanzierendes Element zur protestantischen Reformation darstellt, bekräftigt jedoch gleichzeitig ihr Engagement für den bisher eingeschlagenen Weg des Dialogs.
War es doch ein Papst, Leo X., der 1521 die Exkommunikation über Martin Luther verhängte.
Doch gerade dank des Dialogs und der gegenseitigen Anerkennung ist die Ökumene heute keine Verpflichtung mehr, Unterschiede aufzuheben, sondern bringt den Willen zum Ausdruck, gemeinsam Wege der Gerechtigkeit, der Wahrheit, des Dienstes und der Hoffnung zu beschreiten.
In diesem Sinne wird die Wahl von Papst Leo XIV. als Gelegenheit begrüßt, den brüderlichen Dialog mit Vertrauen und Offenheit fortzusetzen.

Eine gemeinsame Agenda
Die ELKI erkennt in der ersten Rede des neuen Papstes den Widerhall vieler Themen, die auch der lutherischen Tradition am Herzen liegen.
Der Ruf nach unbewaffnetem Frieden, wirtschaftlicher und sozialer Gerechtigkeit, Sorge für unser gemeinsames Zuhause und ein offenes Ohr für die Bedürftigsten.
Sie sieht darin einen Horizont des gemeinsamen Engagements, der bereits während des Pontifikats von Franziskus mit Begeisterung verfolgt wurde.
In dieser von Kriegen, Ungleichheiten, ökologischen und spirituellen Notlagen geprägten Zeit haben die Kirchen die Verantwortung, ein alternatives, prophetisches Zeugnis sichtbar zu machen, das auf dem Evangelium Christi gründet.
Das Engagement der ELKI für Einheit in Vielfalt
Die ELKI bekräftigt ihr Engagement, den Weg des ökumenischen Dialogs mit den katholischen Brüdern und Schwestern fortzusetzen.
Ein Dialog, der in den letzten Jahrzehnten trotz Hindernissen und Schwierigkeiten konkrete Ergebnisse hervorgebracht hat.
Die Begegnung zwischen verschiedenen christlichen Traditionen ist daher möglich, wenn wir im Dienst am Nächsten, im Streben nach dem Gemeinwohl und in der auf Gnade gegründeten Hoffnung einander erkennen. Einheit ist nicht Uniformität, sondern gelebte Gemeinschaft in der Verschiedenheit.
Grußwort und Einladung
Am Beginn dieses neuen Pontifikats richtet die Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien Worte des Gebets und der Ermutigung an die katholische Kirche.
Mit einer erneuerten Einladung zur Begegnung und zum Zuhören, um gemeinsam, Lutheraner und Katholiken, glaubwürdige Zeugen des Evangeliums in der Welt zu sein – mit Mut, Demut und Barmherzigkeit.
Um Brücken zu bauen und die christliche Stimme für Gerechtigkeit, Frieden und den Schutz der Schöpfung zu stärken.

Synode 2025: eine lebendige Kirche
Die ELKI-Synode 2025 stärkt die lutherische Gemeinschaft in Italien: mehr Beteiligung, Ausbildung, ökumenisches Engagement und Kommunikation.
Vorbereitung auf die Zukunft
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien (ELKI) zeigt in den ersten beiden Arbeitstagen der Synode 2025 einen klaren Wunsch nach Erneuerung. In einer zunehmend säkularisierten Welt investiert die ELKI in die Gemeinden, die theologische Ausbildung und die Kommunikation, um ihre Präsenz und Mission zu stärken.
Die Berichte von Dekan Carsten Gerdes und Präsident Alfredo Talenti sowie die Überlegungen aus der Gruppenarbeit bieten daher einen realistischen, aber auch zuversichtlichen Blick auf den möglichen Weg.

Der aktuelle Kontext: zwischen Herausforderung und Chancen
Säkularisierung und schrumpfende Mitgliederzahlen sind eine große Herausforderung für die ELKI. Die Synode betrachtet diese Schwierigkeiten jedoch als eine Gelegenheit, das Wesentliche wiederzuentdecken: das im Wort und in der Gnade verwurzelte evangelische Zeugnis. Das Ziel besteht daher nicht darin durchzuhalten: Wir müssen uns selbst erneuern, neue Wege finden, um das Evangelium zu bezeugen, authentische Beziehungen zu den Menschen aufzubauen und eine Kirche zu werden, die in der Gesellschaft immer stärker verwurzelt und lebendig ist.
25. April
Der Präsident der Synode, Alfredo Talenti, wollte die Synodenmitglieder daher ausdrücklich auf das Zusammentreffen der Arbeiten mit dem Tag der Befreiung Italiens aufmerksam machen. „Es ist wichtig, dass wir uns an diesen weltlichen und italienischen Jahrestag erinnern“, sagte er.

Stärkere und besser vernetzte Gemeinden
Eines der Hauptziele der Synode 2025 ist es, die lokalen Gemeinden zu stärken und ihren Zusammenhalt zu fördern. Die Zusammenarbeit, die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und die Förderung einer aktiven Beteiligung sind grundlegende Strategien, um ein „Wir“ aufzubauen, das in der Lage ist, die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft zu bewältigen. Aber auch, um in diesem Prozess den Weg zu einer ELKI einzuschlagen, die wirklich das Erbe aller ist.
Ausbildung neuer Pastoren: Investition in die Zukunft
Auch die theologische Ausbildung stellt eine Säule des Erneuerungsprojekts dar. Angesichts der Realitäten der Gegenwart sind die Lutheraner aufgefordert, die Bildung eines pastoralen Gremiums zu fördern, das den Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist. Dies geschieht durch die Unterstützung der Ausbildung neuer Pfarrerinnen und Pfarrer und durch die Erkundung neuer Möglichkeiten der Ausbildung und Übernahme von Verantwortung.

Ein besser sichtbares ökumenisches und soziales Engagement
Die ELKI-Synode bekräftigt die Bedeutung des ökumenischen Dialogs und des sozialen Engagements. Durch die Zusammenarbeit mit den anderen evangelischen Kirchen und die Aufmerksamkeit für die Fragen der sozialen Gerechtigkeit wird öffentliche Rolle der ELKI in Italien und Europa gestärkt.
Kommunizieren, um Beziehungen aufzubauen
Kommunikation ist daher ein strategisches Element für die ELKI. Es genügt nicht zu informieren, sondern es ist notwendig, Beziehungen aufzubauen, einen Dialog mit der Gesellschaft zu führen und die Botschaft des Evangeliums auf eine zugängliche und zeitgemäße Weise sichtbar zu machen.
Wir müssen uns bewusst machen, dass wir im öffentlichen Raum leben, und versuchen, die Werte, den Standpunkt und die Besonderheiten unserer evangelisch-lutherischen Kirche in Möglichkeiten des Austauschs, der Konfrontation und des Zuhörens umzusetzen.

Ein neues Abkommen zwischen Gemeinden und ELKI
Die Synode befasste sich auch mit den Beziehungen zwischen den fünfzehn Gemeinden und der nationalen Struktur der ELKI. Mehr Zusammenarbeit, mehr gegenseitige Unterstützung, mehr Mitverantwortung: das sind die Eckpfeiler einer Kirche, die ein lebendiges Netzwerk sein will und nicht eine Ansammlung isolierter Realitäten.
Aber auch einer Kirche, die als solche eine geeinte Einheit sein will, die es versteht, die Erfahrungen und Autonomien, die jede Gemeinde lebt und repräsentiert, gemeinsam zu schätzen.

Mit Zuversicht und Dankbarkeit in die Zukunft blicken
Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Intesa mit dem italienischen Staat bedankt sich die ELKI für die geleistete Arbeit und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Die Synode 2025 zeigt einen Weg der Erneuerung, in Treue zum Evangelium und im Dienst am Nächsten.

ELKI-Synode: Gemeinsam Zukunft planen
Vom 24. bis 27. April denken die lutherischen Gemeinden Italiens in Rom über Identität, Berufung und Wandel nach
Die 24. Synode
Vom 24. bis 27. April findet in Rom die Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien (ELKI) statt. Ein wichtiger Termin für den Weg der lutherischen Gemeinden in Italien.
Das Thema dieser zweiten Tagung der 24. Synode lautet „Gemeinsam Zukunft planen“ und wird als Einladung verstanden, über die aktuellen Herausforderungen und Chancen nachzudenken, die die ELKI in den kommenden Jahren erwarten. Eine Synode hinter verschlossenen Türen, mit einem internen und vertraulichen Charakter, aber deshalb nicht weniger partizipativ oder relevant.
Wir sprachen darüber mit dem Präsidenten der Synode, Dr. Alfredo Talenti. Lesen wir gemeinsam, was er geantwortet hat.
Die Synode 2025 hat beschlossen, eine interne Veranstaltung zu sein. Warum diese Entscheidung und was erwarten Sie von diesem zurückhaltenderen Format?

Die Entscheidung wurde bereits vor meiner Wahl im April 2024 getroffen und zwar ausschließlich aus logistischen Gründen: In Rom wäre es aufgrund des Jubiläums der katholischen Kirche im Jahr 2025 praktisch unmöglich gewesen, das übliche erweiterte Kontingent an Zimmern zur Unterbringung von Gästen zu buchen.
Das hat mir nicht gefallen, denn die Synode ist auch eine Gelegenheit, mit Brüdern und Schwestern aus anderen Kirchen und Konfessionen zusammenzukommen, eine Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen. Daher sollte diese erste Synode der neuen Präsidentschaft sicherlich nicht als Zeichen der Abschottung interpretiert werden, was weder unserem Temperament noch der eigentlichen Natur der ELKI entspricht. Die ELKI ist gerade heute, in einer Zeit großer Mobilität, eine Kirche der Begegnung zwischen Menschen, die auf verschiedenen Wegen zwischen Italien und Deutschland unterwegs sind. Aber nicht nur das: Es gibt so viele Geschichten, dass es schön wäre, sich die Zeit zu nehmen, sie zu erzählen und zu verstehen, gemeinsam. Und tatsächlich wollten wir dann mit dieser Synode die Gelegenheit nutzen, uns „ein wenig Zeit zu nehmen“, insbesondere um etwas ausführlicher über unsere ELKI zu sprechen.
Das Motto „Gemeinsam Zukunft planen“ lässt auf einen Tempowechsel schließen. Gemeinsam, um eine gemeinsame, geeinte Planungsperspektive zu bekräftigen: Ist dies ein möglicher Weg in einer „föderalen“ Kirche, die eine weitgehende Autonomie und Unabhängigkeit der Gemeinden anerkennt?
Natürlich ist dies kein einfacher Weg, aber die jahrhundertealte Geschichte der heutigen Welt ist von derselben Herausforderung geprägt: Können nur autoritäre, von oben herab verordnete und charismatische Strukturen existieren, oder ist es nicht dringend notwendig, gerade jetzt zu zeigen, dass Autonomie und Unabhängigkeit wirksame und mit der Zeit vielleicht noch wirksamere Formen der Zusammenarbeit finden können?
In unserer Arbeit als Kirche, die sich auf ihre Gemeinden stützt, können wir den Wert des Dialogs zwischen den Menschen im Rahmen des Dialogs des Glaubens bezeugen.

In den Arbeitsgruppen werden sensible Themen wie die Organisation des Pfarramtes oder die wirtschaftliche Nachhaltigkeit behandelt. Welche Beziehung besteht zwischen diesen beiden Aspekten und was erwartet die Gemeinden in naher Zukunft?
Finanzielle und personelle Ressourcen bestimmen die Organisationsform einer Kirche wie jeder anderen Einrichtung mit. Eine Kirche unterscheidet sich jedoch dadurch, dass sie auf transzendente Bedürfnisse und Werte reagiert.
Jede durch kontingente Bedürfnisse bedingte Änderung der Form beeinträchtigt nicht die Verfolgung dieser Bedürfnisse und Werte im Einklang mit dem Geist der Ecclesia semper reformanda.
Die Gemeinden müssen zu neuen Lebensformen finden, die weniger auf die traditionelle Figur des Gemeindepfarrers ausgerichtet sind, und sie müssen den Zusammenschluss untereinander verstärken. Dies bestätigt, um auf die vorhergehende Frage zurückzukommen, dass die Achtung der Unabhängigkeit und das gemeinsame Bemühen zunehmend nebeneinander bestehen müssen, und diese Synode soll ein wichtiger Schritt in diese Richtung sein.
Wir befinden uns in einer komplexen historischen Phase. Die Kirchen leben alle in der Sorge um die Zukunft. Sehen Sie darin nicht die Gefahr, dass die Synode zu einem „Cahier de doléances“ wird und am Ende zu Entscheidungen kommt, die von Sorgen bedingt sind?
Dieses Risiko wollen wir vermeiden, schon bei der Wahl des Mottos, das genau dies unterstreichen soll.
Die Diskussion darf nicht vorgefasst sein über bestehende Formen, „was behalten wir, was streichen wir schmerzhaft, die Zukunft als absolute Unbekannte.“
Nein, die Perspektive ist im Heute verwurzelt, aber es ist ein Heute, von dem die Planung und Gestaltung der Zukunft ein integraler Bestandteil ist.
Welche Rolle sollte Ihrer Meinung nach die Kommunikation auf diesem Weg spielen?
Eine grundlegende Rolle, keine Frage, und das zeigt sich auch in der Entscheidung, sich ein Motto zu geben, einen „Titel“, der prägnant und allgemein ist, aber mit vielen Inhalten aufgeladen werden kann.
Wir stehen heute vor und inmitten einer technologischen Mutation, die anthropologisch wird.
Die Bedeutung des visuellen Aspekts und des prägnanten, vereinfachten Wortes mag man mögen oder nicht, aber sie sind eine Tatsache, der sich die Kirchen nicht entziehen können. Vielmehr haben sie die Pflicht, Bilder und Worte zu finden, die reich an Inhalt und Emotionen sind und ein Gegengewicht zu den oft stark „bösartigen“ Bildern und Worten bilden können.
Welche Botschaft möchten Sie heute den Gemeinden, den Pfarrern, den Präsidenten und den Mitgliedern der ELKI im Hinblick auf diese Synode übermitteln?
„Mehr Zusammensein“ und „mehr Planung“: Das ist eine Möglichkeit, die mit Gottes Hilfe ein Geschenk ist.
Dialog, Planung und Zusammenarbeit
Im Laufe der Tagung und insbesondere während des Thementages am Freitag, den 25. April, werden sich die Synodalen aktiv an Arbeitsgruppen beteiligen, die sich mit strategischen Fragen befassen, wie zum Beispiel:
- Leben und Entwicklung der lokalen Gemeinden
- Gegenwart und Zukunft des Pfarramts
- Die interne Organisation der ELKI als kirchliche Struktur
- Finanzen von Kirchen und Gemeinden
- Der öffentliche Auftrag der ELKI im italienischen Kontext
- Interne und externe Kommunikationsstrategien
Jede Gruppe wird von Experten und im kirchlichen Leben engagierten Personen moderiert und soll einen Abschlussbericht verfassen, der dann in eine gemeinsame Reflexion mündet, die für die Ausarbeitung konkreter Vorschläge nützlich ist.
Gemeinsame Erkenntnis
Das erklärte Ziel besteht daher darin, diesen Moment in eine Chance für kollektives Wachstum umzuwandeln, im Bewusstsein, dass der aktuelle Kontext neue Visionen, größere Flexibilität und ein erneuertes Gefühl der Mitverantwortung erfordert. Es geht also nicht nur darum, praktische Entscheidungen zu treffen, sondern darum, die eigentliche Bedeutung des Kircheseins in der heutigen Zeit zu hinterfragen, in der Pluralität lokaler Kontexte und der Komplexität der heutigen italienischen Gesellschaft.

Acht-Promille der evangelisch-lutherischen Kirche: Start der Kampagne 2025
Informieren Sie sich über die Kampagne 2025: wie Sie spenden können, welche Projekte unterstützt werden und die Botschaft #siamosale aus dem Evangelium.
Im Mittelpunkt die Botschaft #siamosale
Morgen beginnt offiziell die Acht-Promille-Kampagne 2025, die von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien (ELKI) gefördert wird. Die für dieses Jahr gewählte Botschaft lautet #siamosale und ist vom Matthäusevangelium 5:13 inspiriert: „Ihr seid das Salz der Erde“. Der biblische und theologische Bezug bildet den Leitfaden der gesamten Kampagne, die von Yoge Comunicazione Sensibile in Zusammenarbeit mit der Kommunikationsabteilung der ELKI erstellt wurde.
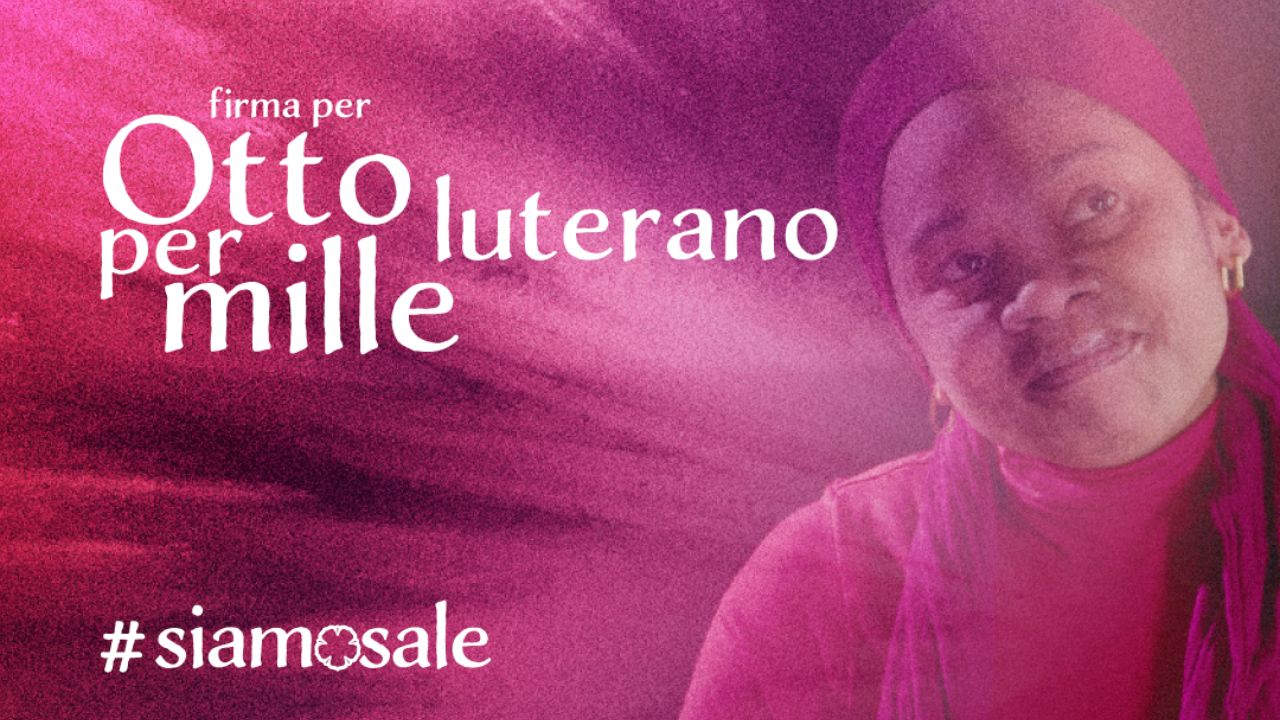
Bei den vier Hauptthemen der Kampagne Kindheit und Familie, Jugend, ältere Menschen und Migranten geht es darum, über grundlegende Bestandteile unserer Gesellschaft zu berichten, die oft unter Ausgrenzung, Einsamkeit, Gleichgültigkeit und Diskriminierung leiden.
Warum es wichtig ist, sich dafür zu entscheiden
Die acht Promille des IRPEF sind ein Teil der Einkommenssteuer, den jeder Bürger und jede Bürgerin dem Staat oder einer anerkannten Religionsgemeinschaft, darunter der ELKI, zuweisen kann. Wer keine Wahl trifft, lässt dennoch zu, dass sein Anteil auf Grundlage der Wahl der anderen Beitragszahler verteilt wird. Aus diesem Grund ist es wichtig, eine Präferenz zu äußern, um direkt zur Unterstützung von Projekten der Solidarität, Kultur, Bildung und Hilfe beizutragen.

Wo kann man die Kampagne der evangelisch-lutherischen Kirche sehen?
Die Kommunikationskampagne 2025 wird auf digitalen Kanälen, in sozialen Netzwerken und zum ersten Mal auch auf La7 und La7+ (smartv) zu sehen sein, um die Botschaft der ELKI einem noch größeren Publikum zu vermitteln. Das Hauptvideo, das von Artescienza (Genua) erstellt wurde, und Berichte aus den Gemeinden Triest, Venedig, Meran und Turin erzählen von den Projekten, die mit Unterstützung der Acht Promille finanziert wurden.
Die Bedeutung der Entscheidung: konkrete Hilfe
Der Acht-Promille-Fond der evangelisch-lutherischen Kirche ist ein Instrument, das jedem zur Verfügung steht, um Emanzipationsprojekte für Menschen in prekären Verhältnissen zu unterstützen. Die einfache Geste einer Unterschrift ermöglicht es evangelisch-lutherischen Gemeinden und Organisationen, im Namen aller zu handeln und Frieden, soziale Gerechtigkeit und Akzeptanz zu fördern.

Warum die ELKI?
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien ist eine lebendige und verwurzelte Glaubensgemeinschaft. Mit den Acht Promille fördert sie soziale Interventionen, Kultur- und Bildungsinitiativen und bietet Unterstützung für ausgegrenzte oder diskriminierte Menschen. Spenden bedeutet, sich einem Netz konkreter und umfassender Solidarität anzuschließen.
Nützliche Informationen
Die acht Promille können Sie der ELKI in Ihrer Online-Steuererklärung, beim CAF oder bei Ihrem Steuerberater zuweisen. Weitere Informationen finden Sie hier:
www.chiesaluterana.it/8-per-mille
Teilen Sie die Kampagne, sprechen Sie über die Acht Promille der evangelisch-lutherischen Kirche. Tragen auch Sie Ihren Teil bei auf dem Weg, das Salz der Erde zu werden.

Theater auf Sardinien dank Acht Promille der evangelisch-lutherischen Kirche
Theatersaison in Serrenti wird mit Unterstützung der Acht Promille der ELKI eröffnet
Sommertheater: Lutheraner unterstützen mit Steuergeldern Kultur und Integration
Das Teatro Comunale von Serrenti (Provinz Südsardinien) öffnet seine Türen für die fünfte Ausgabe der Teatri d’Estate, die von der Theatergruppe Il Salto del Delfino gefördert wird.

Inklusion und Theater für alle
Die Theatergruppe Il Salto del Delfino beschränkt sich nicht auf die Bühne, ihr soziales Engagement ist sehr vielfältig. Sie organisiert inklusive Theaterworkshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und ist darüber hinaus in verschiedenen Schulen auf Sardinien aktiv. Sie fördert die persönliche Entwicklung durch Kunst und bietet Kurse an, die auf die Entwicklung von Kreativität und Selbstbewusstsein ausgerichtet sind.
Die Acht Promille der ELKI: konkrete Unterstützung
Die Teatri d‘Estate werden auch dank der Unterstützung durch den Acht-Promille-Fond der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien (ELKI) realisiert. Mit diesem Beitrag werden kulturelle und soziale Projekte in der Region unterstützt. Das Theater wird so zu einem Instrument für Gemeinschaft, Reflexion und Inklusion.
Kultur, Territorium und Engagement
Mit der Schirmherrschaft der Gemeinde Serrenti und dem Beitrag der Autonomen Region Sardinien zeigt das Theater, dass es in der Lage ist, eine Verbindung zwischen Kunst und Bürgerschaft herzustellen. Eine Einladung zur Teilnahme, zur Unterstützung und zum gemeinsamen Erleben von Theater.

Theater ohne Grenzen in Lecce
UNicA Senzaconfini, eines der 26 vom Acht-Promille-Fond der evangelisch-lutherischen Kirche finanzierten Projekte, fördert Integration und Wachstum durch Kunst, Bildung und Kultur im Theater NASCA in Lecce.
Ein Projekt für die Gemeinschaft über die Grenzen hinaus
Das Projekt UNicA Senzaconfini wurde ins Leben gerufen, um die Vorstellung von Grenzen von einer Barriere in einen Punkt der Begegnung zwischen Menschen zu verwandeln. Das im NASCA il teatro, einem Kulturzentrum in einem Vorort von Lecce, realisierte Projekt stellt eine politische und poetische Aktion dar, die darauf abzielt, neue Verbindungen zwischen den Einwohnern zu schaffen. Diese Initiative gehört zu den 26 Projekten, deren Finanzierung für 2024/2025 durch den Acht-Promille-Fond der evangelisch-lutherischen Kirche in Italien unterstützt wird, was das Engagement für gesellschaftlichen Zusammenhalt durch Kunst bestätigt.
Raum für Wachstum und Kreativität
NASCA ist nicht nur ein Theater, sondern eine ständige Künstlerresidenz, ein Raum für Ausbildung, Unterhaltung, Kino und Workshops. Hier wird die Kunst zu einem Instrument des sozialen Wandels, das Bürgerinnen und Bürger, Künstlerinnen und Künstler auf einen Weg des gemeinsamen Wachstums führt. Ziel ist es, in der Nachbarschaft zu beginnen, in Dialog mit der Stadt zu treten und über die Landesgrenzen hinaus zu blicken, um eine Gemeinschaft aufzubauen, die auf Vielfalt und Integration basiert.
Kostenlose Workshops für Kinder und Jugendliche
Ein zentrales Element des Projekts ist eine kostenlose künstlerische Ausbildung, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Die Workshops, die sich an verschiedene Altersgruppen richten (6-8 Jahre, 9-11 Jahre, 12-16 Jahre), zielen darauf ab, Kreativität, Ausdruck und ein Gefühl der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft zu entwickeln. Die Initiative wird durch die freiwilligen Beiträge von Familien und Einwohnern in einem System der tugendhaften Solidarität ermöglicht, in dem diejenigen, die mehr haben, für diejenigen spenden, die sonst nicht teilnehmen könnten.
Ein tief verwurzeltes und wachsendes Projekt
Nach drei Jahren Laufzeit des Projekts ist eine immer größere Beteiligung der Bevölkerung festzustellen. Neben Workshops veranstaltet NASCA auch Theateraufführungen, Konzerte, Ausstellungen, Lesungen und Buchpräsentationen und bietet so einen reichhaltigen Kalender mit vielfältigen kulturellen Veranstaltungen. Die aktive Beteiligung der Einwohner wird auch durch die Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen wie Volare Alto, der Genossenschaft L’Albero, dem Verein Triacorda und der Kirchengemeinde sowie durch die Unterstützung des Sozialamtes gefördert.
Ganzjährig interessante Angebote
Die Aktivitäten finden das ganze Jahr über statt:
- Januar – Mai / November – Dezember: öffentliche Veranstaltungen mit Theater, Musik, Tanz, Poesie, Film und Kunst.
- Januar – Mai / Oktober – Dezember: Workshops für Kinder und Jugendliche.
- Juni – August: Schließung oder Nutzung des Raums für Künstlerresidenzen und soziale Projekte.
Dank der Unterstützung durch die Acht-Promille-Gelder der evangelisch-lutherischen Kirche wächst UNicA Senzaconfini weiter und beweist, dass Kunst eine Brücke für Integration und gesellschaftliche Teilhabe sein kann.






